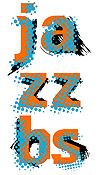Verblüffende Klangwelten
Improvisation mit angezogener Handbremse
Das Lisbeth-Quartett verändert das übliche Jazz-Improvisations-Schema
Das war absolut ungewohnt. Ein Jazzkonzert, in dem es – bis auf eine Ausnahme – keinen Zwischenbeifall für Soloparts gab! Ist ja sonst so üblich bei den Jazzern. Es wird ein Thema eingeführt, eine Akkordfolge entfaltet und alsbald geht es über in das Thema-Solo- Schema. Die Band tritt dann in den Hintergrund, der Solist brilliert – Beifall! Und dann die nächste Runde, same procedure…
Damit hat Altsaxofonistin und Komponistin Charlotte Greve mit ihrem Lisbeth-Quartett offenbar nicht viel am Hut. Ihre Kompositionen beginnen in der Regel mit kurzen Tonfolgen, die immer wieder leicht abgewandelt werden, zögerlich-suchend fast. Bass, Piano und Schlagwerk reagieren darauf höchst unterschiedlich. Mal Frage-Antwort-Spiel, mal Unisono, dann vom Takt her verzögert. Es gibt andere Akzentuierungen und Erweiterungen, die sich zu einem immer dichteren Zusammenspiel aufschwingen.
Aus diesem Klanggewebe heben sich – inselartig – Einzelstimmen heraus, ohne dass der Rest der Band pure Begleitung wird. So hebt Charlotte Greve mit ihrem Altsaxofon oft für eine Weile ab mit ungemein beweglichem, variantenreichem, schön artikuliertem Spiel. Währenddessen tun sich Pianist Manuel Schmiedel und Marc Muellbauer am Bass zusammen und verdichten das Ganze mit mal abstrakten, mal sehr harmonischen Dialogen. So hat man dann einen vom Tempo, Rhythmus, der Dynamik, dem solistischen Anteil her ständig wechselnden musikalischen Bewusstseinsstrom. Das alles läuft ohne Effekthascherei mit erstaunlicher Präzision, höchst kontrolliert. Aber – vielleicht etwas unterkühlt?
Ganz verblüffend ist, wie Schlagwerker Moritz Baumgärtner das Arbeitsprinzip der Band auf sein Instrument überträgt. Das klappert, raschelt, knallt, quietscht, klingelt, kratzt, schabt, dämpft, wirbelt. Und dazu braucht es Sticks, Schlägel, Ruten, Besen, Dämpfer, Stäbe, Drähte, Stifte, Geigenbögen. Er ist ein permanenter Unruheherd, ohne das Gesamtkonzept der Aufführungspraxis zu torpedieren.
Medizinisch gesprochen, könnte man sagen, dass insgesamt betrachtet die Wirkung der Musik nicht intravenös (volle Dröhnung), sondern eher subkutan, also unter die Haut platziert, erzielt wird.
Mit einer Ausnahme: Der Zugabe. Da passierte das, was ausgeschlossen schien: Pianist Manuel Schmiedel übernahm explizit die Solistenrolle und spielte wie losgelöst, den Rest der Band mit sich reißend. Und da gab es den bekannten Zwischenbeifall des zahlreich erschienenen kundigen Publikums im Theatersaal des Braunschweiger Lindenhofes.
Klaus Gohlke