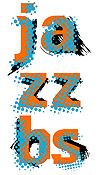Konzentrieren wir uns doch auf die Musik
Geschlechtergerechtigkeit ist für die Hannoveraner Bandleaderin, Schlagzeugerin und Jazzprofessorin Eva Klesse ein wichtiges Thema
Eva Klesse spielt am Freitag, 14. Februar 2020 im Roten Saal Braunschweig mit ihrem Quartett Modern Jazz. Sie war 2018 die erste Jazz-Instrumentalprofessorin und lehrt an der Hochschule für Musik in Hannover. Klaus Gohlke sprach mit ihr über die Genderthematik im Jazz.
Frau Klesse, in Deutschland gibt es zwei Instrumentalprofessorinnen für Jazz. Sie sind eine davon. Was ist das Besondere daran im Vergleich zu anderen Lehrenden im Studiengang Jazz?
E.K.: Ich denke, das Besondere ist, dass es immer noch als etwas Besonderes angesehen wird (obwohl wir denken, dass wir – was Gleichstellung in unserer Gesellschaft angeht – angeblich schon „so wahnsinnig weit“ sind und obwohl gerade wir im Jazz, der als progressive Musik angesehen wird, eigentlich Vorreiter sein müssen für gesellschaftliche Prozesse, oder?). Für meine tägliche Arbeit und den Umgang mit meinen Studierenden spielt die Tatsache, dass ich eine Frau bin, keine große Rolle. Das Besondere ist das politische Signal, das von der Berufung von 2 Frauen für diese Stellen ausgeht, die ersten im Jahr 2018, obwohl es Jazz-Ausbildung an Hochschulen schon seit Jahrzehnten gibt. Ich erhoffe mir einen Aufbruch und mehr Diversität unter Studierenden und Lehrenden an Hochschulen, in der Jazzausbildung und überall.
Wolfram Knauer überschreibt ein Kapitel in seiner gerade erschienenen Geschichte des deutschen Jazz: Jazz wird diverser, weiblicher, queerer. Frauen tauchen also auf im Zusammenhang mit Verschiedenartigkeit, mit Normabweichung, wenn man Lexikondefinitionen folgen will. Auch wenn Knauer das nicht so meint, aber Weiblichkeit im Jazz als Abweichung: eine zutreffende Beschreibung?
E.K.: Ich finde das Buch von Wolfram Knauer sehr lesenswert und bin froh, dass auch er dieses wichtige Thema aufgreift. Jazz wird diverser, weiblicher, queerer – das ist/wäre doch ganz wunderbar! Klar waren Frauen bisher in der Jazzwelt/-geschichte die Abweichung von der Norm, aber Wolfram Knauer spricht in seinem Buch ja genau diesen nun stattfindenden und längst fälligen Wandel an: die Szene öffnet sich (und muss sich auch öffnen!), mehr und verschiedenere Menschen finden Platz, Raum und Gehör.
Finden Sie das Tempo im Hinblick auf die Geschlechtergerechtigkeit im Bereich Jazz nunmehr ermutigend oder eher erschreckend?
E.K.: Natürlich dauert das alles lange und manchmal kommt das Gefühl auf, als müsste man wieder neu für Dinge kämpfen, die doch eigentlich schon mal common sense waren. Aber: ich finde es ermutigend, dass gerade ein Wandel stattfindet: gesamtgesellschaftlich und in der Jazzwelt. Und freue mich über alle Kolleginnen und Kollegen, die diesen Weg mitgehen. Erschreckend finde ich den gleichzeitig stattfindenden Backlash, rechts-nationale, rassistische und damit einhergehend auch sexistische und anti-feministische Tendenzen.
Warum ist das mit der Geschlechtergerechtigkeit im Jazz so schwierig?
E.K.: Ich denke, die Gründe für das Geschlechterverhältnis im Jazz sind vielfältig, ebenso wie die Ansätze, um dieses zu verändern. Meine große Hoffnung ist, dass dieses Thema für nachfolgende Generationen irgendwann keine Rolle mehr spielt, ehrlich gesagt, sondern alle ihren Talenten und Neigungen nachgehen können, und sich dabei nicht nach irgendwelchen Gender-Konventionen/ veralteten Rollenbilder richten müssen – Männer wie Frauen! Feminismus und das Streben nach Gleichberechtigung/Gleichstellung sind für alle da!
In Ihrer Band sind Sie die Chefin. Ihre Bandkollegen sind alles Männer. Müssten Sie da nicht gegensteuern, etwa mit reinen Frauenbands (vgl. Marilyn Mazurs „Shamania“).
E.K.: In meiner Band bin ich die Orga-Chefin. Musikalisch wir sind wir ein Kollektiv. Und: ich muss gottseidank gar nix 🙂 Ich finde ja, es sollte alles geben dürfen: Männerbands, Frauenbands, gemischte Bands, diverse Bands. Vielleicht könnte man einfach aufhören, bei „Frauenbands“ immer wieder darauf hinzuweisen, dass es Frauenbands sind. Oder, alternativ: wir sprechen ab jetzt auch immer von Männerbands, wenn wir von rein männlich besetzen Ensembles sprechen. Dann müssten wir aber alle je erschienenen Jazz-Bücher und die gesamte Jazzgeschichte umschreiben. Bisher gab es nämlich ja so gut wie ausschließlich nur Männer-Bands. Reine Männer-Bands, reine Männer-Festivals. Vielleicht wurden die alle ja nur wegen ihres Geschlechts ausgesucht?? 🙂 Sie sehen, manchmal hilft es, sich mal alles umgekehrt vorzustellen, dann wird einem die Absurdität bewusst.
Vielleicht lassen wir diesen ganzen Quatsch aber auch einfach mal und konzentrieren uns auf das, worum es uns ja eigentlich geht: die Musik!
Welche „Jazz-Role-Models“ gab/gibt es für Sie?
E.K.: Viele. Meine Lehrer waren oft role models für mich, weil ich auch so tolle hatte. Heinrich Köbberling war und ist für mich ein Vorbild zum Beispiel, als Lehrer, Mensch und Musiker. Julia Hülsmann war und ist eine ungemein wichtige Mentorin für mich. Brian Blade verehre ich als Schlagzeuger. Daneben aber genau so Joni Mitchell und noch ganz viele andere. Ausserdem alle, die sich – sowohl gesamtgesellschaftlich als auch in unserer Szene – für Gleichstellung und Gerechtigkeit einsetzen. Eine wilde Mischung also.