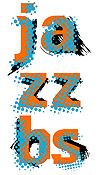Die Raffinesse des sanften Giganten
Ausnahme-Gitarrist Bill Frisell spielt mit seinem Trio ein eindrucksvolles Jazzkonzert im Braunschweiger Westand
Die Konzerteröffnung war bezeichnend. Es ging nicht gleich ab mit dem Opener, nach kurzem Gruß ans Auditorium. Nein, der Bandleader grüßt und stellt als erstes seine Band vor. „Here is Thomas. Thomas Morgan on Bass. And here is Rudy. Rudy Royston on drums.” Ein freundschaftliches, fast familiäres Verhältnis scheint auf, das das Publikum einbeziehen will. Dann erst eröffnet der „Gentle Guitar Giant Bill Frisell“, so Allison Rapp in einem US-Interview,
das ausverkaufte Jazzkonzert am Samstagabend im Braunschweiger Westand.
Ein sanfter Gitarrenriese – das ist irgendwie richtig, driftet doch aber leicht ab in die Klischee-Ecke. Frisell, einer der drei großen Jazz-Gitarristen der letzten Jahrzehnte neben John Scofiled und Pat Metheny, ist kein Mann der rasenden Läufe und des Powerspiels, nicht der Schöpfer höchst komplexer Avantgarde-Musik. Ihm geht es um Klarheit, um das Herausarbeiten der Essenz eines Songs. Jede Note zählt. Etwas spielen bedeutet, etwas aussagen zu wollen. Sofort erkennbar gleich im Opener, Billy Strayhorns bittersüßem und raffiniertem Klassiker “A flower is a lovesome thing”. Da ist ein fast suchendes Changieren zwischen der bekannten Melodie und einem Sich-Entfernen durch Abstraktion. Leise Musik, auf die die Zuhörer sich hinbewegen müssen.
Frisells Trio präsentierte an diesem Abend eine Mischung aus Standards verschiedener Genres, eigenen Kompositionen, Musiken aus verschiedenen Perioden seiner musikalischen Entwicklung. Hörte man allein die Titel, könnte es einen Jazzfan gruseln. Burt Bacherachs „What the world needs now is love“ etwa. Pop! „We shall overcome”, diese abgesungene Protesthymne! Freilich: Bacherachs Pop ist reichlich tricksig, „Overcome“ ist ursprünglich ein Gospel aus dem Jahre 1901. Aber ist das Jazz, wenn man bei anderen Songs umstandslos mit dem Fuß wippen kann, sich in einen Saloon versetzt fühlt ?
Die Frage ist, was man daraus macht. So wurde aus Bacherachs Pop die schöne Melodie herauspräpariert und gleichzeitig jegliche Sentimentalität durch harmonische Mehrdeutigkeiten unterlaufen. Dabei wird deutlich: Frisell ist ein Meister im Umgang mit elektronischen Effekten. Die Protesthymne wird entkernt bis auf die musikalische Substanz, die Aussage geht vom Appell ins melancholisch getönte Hoffen über. Gitarre und Bass umspielen einander arabeskenhaft, fast zärtlich.
Die alte Grundsatzdebatte „Ist das Jazz?“ konnte man aber getrost zu den Akten legen (sollte man vielleicht sowieso tun?), als die Band etwa „Valentine“ spielte. Eine echte Monk-Hommage. Eckiger Blues mit monkischem Riff, zwischendurch heftigst swingend, getragen von Thomas Morgans Walking-Bass-Spiel, das später in ein beeindruckendes Solo überführt wurde. Wobei besonders schön war, dass das Solo nicht zum völligen Verstimmen der restlichen Stimmen führte, diese vielmehr eine feine Folie für Morgans Arbeit bildeten. Rudy Royston präsentierte sich dabei als ungemein feinfühliger Schlagzeuger. Selten konnte man so eine facettenreiche Besen-Arbeit, aber auch schön kraftvoll-rockige Beats hören. Und dann ein Drum-Solo der Extraklasse, bei dem mitzuerleben war, wie er seine Arbeit im Ablauf optimierte, so etwas wie die allmähliche Verfertigung des Rhythmus‘ im Spiel. Ob „Kaddish Waltz“ oder „Lush Life“, ob „Small Town“ oder „Bama Dama“, alles Jazz auf der Höhe der Zeit und gespielt auf höchstem Niveau.
Und das alles ohne Leader- oder Stargetue. Stattdessen freundliche Zuwendung, volle Konzentration auf die Mitspieler, ruhiges und mitunter humorvolles Arbeiten. Das ist insofern erwähnenswert, weil die Tour-Rahmenbedingungen alles andere als angenehm zu bezeichnen sind. Budapest – Berlin – Pori (Finnland) – Braunschweig – Angra (Portugal/Azoren) – Rotterdam, ein Auszug aus dem Auftrittsprogramm dieser Woche. Berlin und Braunschweig, die einzigen Auftrittsorte in Deutschland, spricht für Braunschweig oder? Aber die Umstände?
Modernes Nomadentum des Kulturbusiness. Ist das zuträglich, was das künstlerische Arbeiten betrifft? Ist das angesichts der Klimadebatte noch länger zu rechtfertigen? Müssten sich Agenturen, Veranstalter und Publikum nicht diesen Problemen stellen? Diese Debatte muss geführt werden. Denn so ein Jazz-Abend wie der am Samstagabend im Westand muss grundsätzlich unbedingt erhalten bleiben, wie die begeisterten Publikumsreaktionen zeigten.
Klaus Gohlke

 Der Mann hat eine klare Botschaft, man könnte auch sagen: Er ist Testamentsvollstrecker. Ganz im Geiste der Jazz-Überväter Charlie Parker und Miles Davis hat er keine Lust auf Denkverbote in der Musik. „Ich spiele nicht Jazz, ich mache Musik!“, sprach Miles. Das führt der in Braunschweig geborene und in Köln lebende und lehrende Jazzpianist Jürgen Friedrich am Freitagabend im Braunschweiger Lindenhof bei einem gut besuchten Konzert anschaulich vor. Und zwar höchst spannend, unterhaltsam und hintersinnig. Ein Wechselbad zwischen abstrakter Tontüftelei und Vollbad im Wohlklang. Zwischen traditioneller Komposition und freiestem Spiel. Zwischen neu interpretierter Klassik und rasantem Bebop.
Der Mann hat eine klare Botschaft, man könnte auch sagen: Er ist Testamentsvollstrecker. Ganz im Geiste der Jazz-Überväter Charlie Parker und Miles Davis hat er keine Lust auf Denkverbote in der Musik. „Ich spiele nicht Jazz, ich mache Musik!“, sprach Miles. Das führt der in Braunschweig geborene und in Köln lebende und lehrende Jazzpianist Jürgen Friedrich am Freitagabend im Braunschweiger Lindenhof bei einem gut besuchten Konzert anschaulich vor. Und zwar höchst spannend, unterhaltsam und hintersinnig. Ein Wechselbad zwischen abstrakter Tontüftelei und Vollbad im Wohlklang. Zwischen traditioneller Komposition und freiestem Spiel. Zwischen neu interpretierter Klassik und rasantem Bebop.